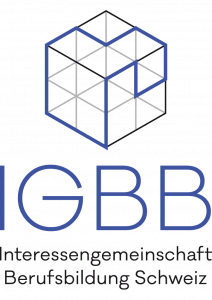Relevanz von Bildungs-Kollaborationen
Der Sinn einer Bildungs-Kollaboration liegt in der Erkenntnis, dass Bildung eine komplexe und vielschichtige Aufgabe ist, die am effektivsten durch eine koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Akteure bewältigt werden kann.
Eine „Bildungs-Kollaboration“ bezieht sich im Allgemeinen auf eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungsakteuren, wie Lehrbetrieben, Organisationen der Arbeitsweilt OdA, Bildungsorganisationen oder Bundesämtern, um gemeinsame Ziele im Bildungsbereich zu erreichen. Mit der technischen Innovation steigen auch die Anforderungen an eine agile Berufsbildung. Umso wichtiger werden Verbands übergreifende Bildungs-Kollaborationen.
Bündelung von Ressourcen
Durch die Zusammenarbeit können verschiedene Institutionen, wie z.B. Organisationen der Arbeitswelt OdA’s ihre Ressourcen gemeinsam nutzen. Dies beinhaltet Fachwissen, Finanzmittel oder Infrastrukturen. Eine effizientere Nutzung der verfügbaren Ressourcen ermöglicht eine bessere Versorgung der Lernenden.
Eine Kollaboration ermöglicht auch den Austausch von Fachwissen und Best Practices zwischen den beteiligten Akteuren. Bildungs-Innovation entsteht dann, wenn durch den Zugang zu verschiedenen Perspektiven und Expertisen innovative Bildungsansätze entwickelt und umgesetzt werden. Nicht zu unterschätzen sind die sich ergebenden Synergie-Effekte, die durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit entstehen.
Stärken der einzelnen Partner nutzen
In einer Bildungs-Kollaboration werden die Stärken der einzelnen Partner genutzt, um bessere Ergebnisse für die Zielgruppen zu erzielen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen, können innovative Lösungen gefunden und umgesetzt werden. Diese können durch einzelne Akteure allein nicht erreicht werden.
Somit wird auch der Aufbau eines Netzwerks von Bildungsakteuren ermöglicht, die sich regelmässig austauschen und voneinander lernen. Über institutionelle Grenzen hinweg werden Dialog und Wissensaustausch gefördert, was die Essenz einer zielgerichteten Bildungspolitik entspricht.
Ganzheitlicher Ansatz
Durch die ganzheitliche Betrachtung können z.B. neue Bildungsansätze umfassender gestaltet werden. Dies, um den Bedürfnissen der Lernenden und den Lehrbetrieben gerecht zu werden. Somit können Bildungskollaborationen einen ganzheitlichen Ansatz fördern, bei dem verschiedene Aspekte der Bildung (Bildungspläne, Verbands übergreifende Zusammenarbeit in der Berufsentwicklung und dgl.) koordiniert werden.
Insgesamt zielt eine Bildungs-Kollaboration darauf ab, die Schweizer Bildungslandschaft zu verbessern, indem sie die Stärken verschiedener Akteure kombiniert, die Zusammenarbeit fördert und innovative Lösungen hervorbringt, um Bildungsziele effektiver zu erreichen.
Herausfordernde Zeiten erfordern spezielle Massnahmen
Wir befinden uns in einer herausfordernden Zeit, was die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften betrifft. Die Energie- und Klimapolitik verlangt nach zielgerichteten Dialogen, um Ressourcen zu optimieren, bewährte Praktiken auszutauschen und eine ganzheitliche Unterstützung für die Lernenden und deren Lehrbetriebe zu gewährleisten. Somit sind Bildungs-Kollaborationen von entscheidender Bedeutung. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können Bildungsakteure besser auf die Bedürfnisse aller Beteiligten reagieren und die Qualität der Berufsausbildung verbessern.
Anspruch und Erwartung der Lernenden
Die Berufsbildung steht vor der Herausforderung, den Ansprüchen der Lernenden gerecht zu werden. Dieser bezieht sich auf deren Erwartungen, Forderungen und Bedürfnisse im Bildungsprozess.
Lernende haben das Recht, qualitativ hochwertige Bildung zu erhalten und ihre individuellen Ziele zu verfolgen.
Lernende haben das Recht, qualitativ hochwertige Bildung zu erhalten und ihre individuellen Ziele zu verfolgen.
IG Berufsbildung IGBB, 2023
Es ist unsere Aufgabe, die Bedürfnisse und Rechte der Lernenden zu respektieren und zu erfüllen. Dadurch wird ihre Motivation, Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit gestärkt, was wiederum zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Berufsausbildung führt.
Wir setzen uns ein…
Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um neue Brücken zu Bildungs-Kollaborationen zu bauen. Vordergründig aufgestellte Sachzwänge, teilweise auch in persönlichen und ideologischen Gründen wurzelnd, haben ausgedient. Die vernetzte Betrachtung zur ganzheitlichen Lösungsfindung steht im Vordergrund.
Die Berufsbildung ist das Rückgrat der Wirtschaft. Und wer in die Berufsbildung investiert, investiert in eine nachhaltige Zukunft.
Diskutieren Sie mit und schreiben Sie Ihre Meinung dazu in die Kommentare.
Wir werden diese dann auch beantworten.