Mehr Ferien für Lernende: Eine Investition in die Bildungsqualität
Die Lernfähigkeit junger Menschen hängt stark von ausreichenden Erholungsphasen ab.
Ein Zusammenhang, der in bildungspolitischen Diskursen zunehmend Beachtung findet. Trotz dieser Erkenntnis bleibt die Ferienregelung für Lernende in der Schweiz weitgehend unverändert. Dabei mehren sich die Hinweise auf strukturelle Überlastung und deren Folgen:
Hohe Abbruchquoten, psychische Belastungen und sinkende Ausbildungsqualität.
Während skandinavische Länder mit grosszügigen Erholungsphasen reagieren und diese als festen Bestandteil ihrer Bildungssysteme etablieren, verharrt das Schweizer Modell bei minimalen Standards.
Die Frage drängt sich auf: Sind strukturelle Anpassungen überfällig?
Zwischen Betrieb und Berufsschule: Eine strukturelle Belastung
Fünf Ferienwochen jährlich sind gesetzlich vorgesehen.
Lernende leisten weit mehr als nur schulische Präsenz. Sie stehen zugleich im produktiven Einsatz im Betrieb, müssen Leistungsausweise erbringen und sich auf Prüfungen vorbereiten. In Berufen mit körperlicher Beanspruchung, oder emotionalem Stress summieren sich diese Anforderungen.
Belastungsfolgen sind nachvollziehbar
Studien zeigen: Chronischer Stress und Schlafmangel beeinträchtigen Gedächtnis, Konzentration und emotionale Stabilität.
Die KiGGS-Studie des Robert Koch-Instituts belegt etwa, dass Schlafprobleme bei Jugendlichen eng mit erhöhtem Stresslevel, depressiven Symptomen und verminderter Lebensqualität zusammenhängen (RKI, 2022).
Diese gesundheitlichen Belastungen können zu Motivationsverlust, Frustration und letztlich zu Ausbildungsabbrüchen führen. Das hat Folgen für Lernende, wie auch für die Lehretriebe.
Ein erschöpfter Lernender verliert nicht nur an Motivation, sondern auch zunehmend die kognitive Fähigkeit, komplexe Inhalte zu erfassen und zu verarbeiten.
Das Resultat: Schlechtere Leistungen, wiederholte Abwesenheiten und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Ausbildungsziel nicht zu erreichen.
Internationale Perspektiven: Skandinavien macht es vor
Finnland, Schweden und Norwegen zeigen, dass grosszügigere Ferienregelungen mit hoher Bildungsqualität vereinbar sind.
Lernende in diesen Ländern haben durchschnittlich 12 bis 13 Wochen Ferien pro Jahr. Das ist deutlich mehr als die fünf Wochen, die in der Schweiz gesetzlich vorgesehen sind.
Die längeren Erholungszeiten werden in Skandinavien als zentraler Bestandteil einer gesunden Lernkultur verstanden und verteilen sich über das gesamte Jahr.
Norwegen investiert überdurchschnittlich in Bildung, Finnland verzichtet in den ersten Schuljahren auf Noten und setzt auf Entschleunigung. Internationale Vergleichsstudien bestätigen die positiven Effekte (GoStudent, 2022).
Diese Länder sind Vorbilder für die Schweiz. Sie machen vor, wie ein entlasteter Schul- und Ausbildungsalltag den nachhaltigen Lernerfolg fördert.
Bildungspolitische Dimension: Stabilität und Verbindlichkeit fördern
In der Schweiz wurden im Jahr 2021 fast 22 Prozent der Lehrverträge vorzeitig aufgelöst (BFS, 2023). Die Gründe sind vielfältig:
- Fehlende Passung,
- betriebliche Konflikte,
- gesundheitliche und psychische Überforderung.

Letzteres ist schwer messbar. Dabei liegt hier ein beträchtliches Präventionspotenzial zugrunde. Zeitliche Entlastung ist keine pädagogische Zugabe, sondern eine strukturelle Voraussetzung für nachhaltiges Lernen.
Lehrbetriebe, die flexible Modelle erproben, wie etwa Blockzeiten, Gleitzeit, oder Regenerationsphasen nach Belastungsspitzen, berichten von geringerer Fluktuation und höherer Ausbildungszufriedenheit.
Bildungsökonomische Relevanz
Der wirtschaftliche Schaden vorzeitiger Lehrabbrüche ist erheblich.
Schätzungen beziffern die Folgekosten pro Fall auf mehrere tausend Franken! Dies, durch entgangene Produktivität, Rekrutierungskosten und den Ausfall von Fachkräften in Ausbildung.
Erholte Lernende sind motivierter, belastbarer und erfolgreicher. Das erhöht nicht nur die Ausbildungsqualität, sondern zahlt auch auf die Fachkräftesicherung ein. Betriebe profitieren durch tiefere Abbruchraten und bessere Produktivität.
Im Umkehrschluss bedeutet das: Jede Massnahme zur Stabilisierung des Ausbildungsverlaufs ist auch eine Investition in die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit.
Fazit: Bildungspolitik mit Weitblick gestalten
Der Ruf nach zusätzlichen Ferienwochen mag aus traditioneller Sicht als weich erscheinen. Angesichts der empirischen Fakten aber, ist er Ausdruck einer bildungspolitischen Weitsicht und Systemverantwortung.
Wer Ausbildungsabbrüche vermeiden, Bildungsqualität sichern und Fachkräfte langfristig binden will, muss jungen Menschen die Ressourcen geben, die sie für nachhaltiges Lernen benötigen – und dazu zählt auch Zeit. (Rolf Siebold, 2025)
Deine Meinung ist gefragt
- Wie beurteilst du den Zusammenhang zwischen Erholung und Ausbildungsqualität?
- Welche strukturellen Massnahmen könnten zur nachhaltigen Entlastung von Lernenden beitragen? Aus Sicht der Bildungsqualität und Fachkräftesicherung?
- Welche alternativen strukturellen Massnahmen könnten ebenso zur nachhaltigen Entlastung von Lernenden beitragen?
Hinterlasse einen Kommentar hier im Blog und wir werden ihn bestimmt beantworten.
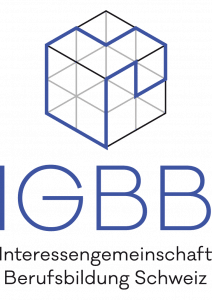




 Bildnachweis:cyano66 Stock-Fotografie-ID:938439650
Bildnachweis:cyano66 Stock-Fotografie-ID:938439650 IGBB
IGBB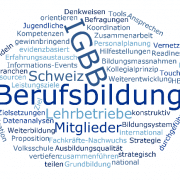 IGBB.ch
IGBB.ch
 igbb
igbb IGBB
IGBB
Rolf
Danke für diesen Beitrag. Mehr Ferien finde ich eine gute Idee, wegen der Fairness gegenüber von Schülern aber auch weil die Jugendlichen das einfach brauchen!
Du schreibst unter anderem „Chronischer Stress und Schlafmangel beeinträchtigen Gedächtnis, Konzentration und emotionale Stabilität.*
Mehr Ferien reduziert nicht unbedingt den Stress. Wenn der Lehrling nämlich zurück im Alltag ist, geht der Druck von neuem los:
– Berufsschule
– Betrieb
Aber vor allem ist der Schlafmangel bei der heutigen Generation-Z (link anklicken) fast immer ein Dauerzustand. Da helfen Ferien kaum.
Zusätzlich erhöht Schlafmangel das Risiko eines Betriebsunfalles.
Da hilft nur ein wenig Selbstdisziplin, d.h. 45 Min bevor ich ins Bett gehe in keinen Screen mehr schauen (i.e. Handy, iPad, usw.) und regelmässig zur gleichen Zeit ins Bett. Nur dann besteht die Chance, dass die Person mindestens 7 Std. Schlaf bekommt (8 wäre schön 😀 ).
Urs
#DrKPImetrics #CyTRAP
Lieber Urs,
Vielen Dank für deinen Kommentar – du sprichst einen wesentlichen Punkt an.
Selbstdisziplin ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der Ausbildung.
Doch gerade in der Praxis zeigt sich, dass Lernende
– ganztags im Betrieb sind,
– die Berufsschule besuchen,
– die Hausaufgaben erledigen,
– den Lernstoff verarbeiten,
– und Bildungsnachweise erstellen.
Und dies meist abends, oder am Wochenende. Die Freizeit ist damit stark begrenzt und echte Erholung bleibt oft auf der Strecke.
Es geht also nicht darum Selbstdisziplin in Frage zu stellen, sondern darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Leistungsfähigkeit und Gesundheit langfristig erhalten bleiben.
Denn wer konstant überfordert ist, verliert nicht an Wille, sondern an Kraft.
Dass es auch anders geht, zeigen Länder wie Finnland oder Norwegen.
Sie bieten mehr Ferien und flexiblere Modelle mit klar messbaren positiven Effekten. Genau da liegt der Anknüpfungspunkt für unsere Diskussion.
Herzlichst
Rolf
Danke für die Antwort Rolf.
Ja mehr Ferien finde ich auch gut.
Nur, den täglichen Druck für meine Generation-Z Lehrlinge wird durch mehr Ferien kaum weniger.
Das es dabei oft zeit über das Wochenende braucht um die Hausaufgaben sauber zu lösen für die Berufsschule ist klar. Das dies die Erholungszeit verkürzt is auch klar.
Doch wie verringern wir den Druck zwischen den erholsamen Ferien. Da hilft mehr schlaf aber sonst?
Teil der Aufgaben im Betrieb lösen… wie manchmal in der Schule eine Hausaufgabenstunde ?
Bin mir noch nicht sicher.
Lieber Urs,
Danke dir für deine Rückmeldung. Solche Fragen bringen die Diskussion weiter.
Mehr Ferien helfen bei der Erholung. Aber der Druck im Alltag bleibt. Wichtig ist, wie die Zeit dazwischen gestaltet wird.
Lernzeiten im Betrieb sind eine gute Idee. In der Praxis ist es aber oft schwierig. Am Freitagnachmittag fehlt die Energie. Der Ort ist nicht ideal. Der Fokus lässt nach und der Nutzen ist begrenzt.
Klar ist: Die Rolle der Berufsbildner im Thema „Ausbildungsqualität“ wird in Zukunft noch wichtiger. Sie müssen Belastung erkennen und in ihrer Mentoren-Funktion passende Bedingungen schaffen.
Vielleicht braucht es nicht mehr Angebote, sondern einen schärfer abgestimmten Rhythmus zwischen Arbeit, Lernen und Erholung. Um dies sicherzustellen, sind in Zukunft Berufsbildner mit tiefgreifender fachlichen Erfahrung, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene intensiv gefordert.
Diesbezüglich hat die Berufsbildung noch einiges an Luft nach oben.
Danke, dass du diesen Gedanken eingebracht hast.
Herzlichst
Rolf
Rolf
Danke für den Beitrag und Urs für den Kommentar. Da muss ich antworten.
1. Ferienzeit: Gymnasiasten haben mehr Ferien als Lehrlinge.
Stimmt schon, mehr Ferien könnten den Lehrlingen helfen, sich besser zu erholen und gestärkt in den Arbeitsalltag zurückzukehren.
Allerdings ist es wichtig, dass die Ferien gut über das Jahr verteilt sind.
Trotzdem, das Risiko, dass die Lehrlinge schon wieder wegen Schlafmangel 1 Woche später übermüdet sind bleibt aber bestehen.
2. Hausaufgaben im Betrieb: Lehrlinge könnten auch einen Teil ihrer Hausaufgaben während der Arbeitszeit im Betrieb erledigen.
Dies könnte ihnen helfen, Berufsschule und Arbeit besser zu vereinbaren.
Es wäre jedoch wichtig, dass die Betriebe dafür geeignete Räumlichkeiten und Unterstützung bieten.
Liebe Sandra
Danke für deinen differenzierten Kommentar. Du sprichst wichtige Punkte an, die wir auch in der Praxis immer wieder diskutieren.
Bei der Ferienzeit ist nicht nur die Anzahl entscheidend, sondern auch deren Struktur. Zusammenhängende Erholungsphasen erlauben es Lernenden, wirklich abzuschalten und sich zu erholen.
Einzelne freie Tage oder eine verkürzte Arbeitswoche (Modell 4-Tage-Woche) mögen attraktiv wirken, sind aber im betrieblichen Alltag schwer umsetzbar. In vielen Unternehmen fehlt dafür die nötige Planungsfreiheit. Zudem erschwert die bereits bestehende Unregelmässigkeit durch Berufsschule oder Berufsmatur eine durchgehende Projektarbeit.
Lernende verlieren so den Anschluss an Zusammenhänge.
Zum Thema Hausaufgaben im Betrieb:
Ja, es gibt Betriebe, die Lernzeiten ermöglichen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass der Nutzen oft begrenzt ist. Lernende verlassen am Freitagnachmittag meist frühzeitig den Arbeitsbereich. Bis sie tatsächlich beginnen, ist es spät und die Konzentration leidet.
Der betriebliche Rahmen ersetzt das schulische Lernen nur bedingt.
Kurz gesagt:
Es geht nicht darum Lernende grundsätzlich zu entlasten, oder ihnen jede Anstrengung abzunehmen. Aber es geht darum Rahmenbedingungen zu schaffen, die echtes Lernen, gesundes Arbeiten und eine langfristige Entwicklung ermöglichen. Dies nicht nur theoretisch, sondern auch im Alltag.
Danke, dass du die Diskussion mit deiner Perspektive bereicherst.
Beste Grüsse
Rolf
Das Gewinnen von gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften ist für die Wirtschaft eine grosse Herausforderung. Dies zeigt sich in einigen Branchen bereits bei der Rekrutierung von Berufslernenden. Lehrstellen können teilweise nicht besetzt werden.
Es entsteht der Eindruck, dass sich die Berufsbildung zu wenig für Lernende engagiere und gegenüber dem Gymnasium an Attraktivität verliere. Im Sinne einer attraktiven Berufsbildung sind deshalb gezielte und koordinierte Anstrengungen nötig, um Jugendliche zu gewinnen und zu fördern. Deshalb befürworte ich mehr Ferien, insbesondere beim Übergang von der Sek und Einstieg in die Lehre.
Berufsbildungsverantwortliche, Ausbildner und Ausbildnerinnen sind entscheidend für eine erfolgreiche berufliche Grundbildung. Sie spielen eine wichtige Rolle, weil sie das Potential von Lernenden erkennen, sich für die Lernende einsetzen, sie begleiten und ihre Erfahrungen mit ihnen austauschen. Das braucht Ressourcen, Engagement, eine Geschäftsleitung, die das erkennt und eine Arbeitsumgebung schafft, welche Leistung aktiv anregt und wertschätzt.
Liebe Isabelle,
Danke für Deinen Kommentar und deiner Unterstützung in diesem zentralen Thema. Inzwischen liegt die ablehnende Haltung des Bundesrats vor. Das ist bedauerlich. Dennoch bleibt klar: Wir bleiben an der Sache dran.
Einige Verbände argumentieren, acht Wochen Ferien seien nicht finanzierbar. Grundlage dafür ist der Hinweis, dass rund ein Drittel der Lehrberufe gemäss EHB-Studie keinen Nettoertrag erwirtschaftet. Das ist eine einseitige Betrachtungsweise. Sie blendet aus, dass Finanzierbarkeit nicht nur über betriebliche Nettoerträge definiert werden kann. Berufsbildung ist ein gesamtgesellschaftliches System. Wenn ein Drittel der Berufe strukturell nicht trägt, stellt sich nicht die Frage, ob Lernende weniger Ferien haben sollten, sondern ob alternative Finanzierungsmodelle nötig wären – etwa eine gezielte Bundeskostenbeteiligung, wie wir sie in anderen Bildungsbereichen längst kennen.
Das würde den sozialen Bildungsfrieden stärken und die Berufsbildung systemisch absichern.
Herzlich
Rolf